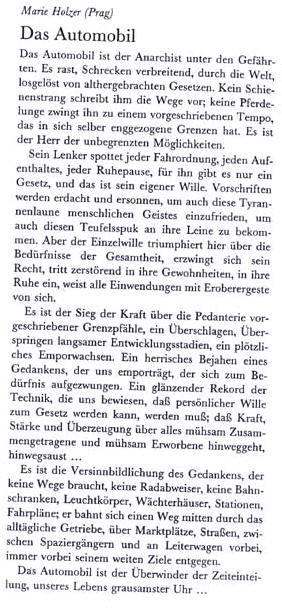Die hier aufgeführten Gedichte sind Schilderung des Großstadtgeschehens, das sich auf der Straße abspielt. In der Regel handelt es sich dabei um feste Straßen im herkömmlichen Sinn, nur in dem Gedicht „Berlin 1“ ist die Straße eine Wasserstraße[145].
Das größte Motiv der Straße ist der Verkehr. Er dehnt sich auf der Straße aus und nimmt einen Großteil von ihr ein. Das ist das Besondere der modernen Stadt[146], weshalb in den Berliner Gedichten auch anzählig so viele Werke zu finden sind, die die Straße mit ihrem Verkehr thematisieren.
Das Thema Technik wurde in der Literatur allgemein zunächst positiv bewertet[147]. Eine besondere Rolle in dieser Einschätzung spielte der Einfluß der Futuristen auf die jungen Intellektuellen in Deutschland[148]. Die Maschinen wurden als Instrument menschlicher Lebenserweiterung gesehen[149]. Das trifft vor allem auf den kurz nach 1900 einsetzenden Aufschwung der Automobilindustrie zu, der dem Einzelnen jetzt eine
ins Vielfach potenzierte[n] Möglichkeit[en] der Fortbewegung und Raumüberwindung
bot[150]. Erstmals in der Geschichte ist Geschwindigkeit individuell nicht nur erfahrbar, sondern bestimmbar und gibt dem Menschen eine so nie gekannte Freiheit.
Diesen Kraft- und Geschwindigkeitsrausch spürt man in dem Gedicht „Autofahrt“ (1911) von Ernst Blass, das eine Reise mit einem Kraftfahrzeug durch das nächtliche Berlin beschreibt. Das Erleben von Technik und Moderne ist hier absolut und wird vor allem durch die Schnelligkeit des Bewegungsprozesses erfahren. Für heutige Begriffe scheint es übertrieben, wenn es in diesem Zusammenhang heißt:
mein Herz ward ausgerenkt
(V 5).
Auch die Frage:
Bin ich hier nicht am Brandenburger Tor?
(V 6),
wirkt für heutiges Verständnis mehr ironisch als authentisch. Der Orientierungsverlust - ausgelöst von der Geschwindigkeit des Automobils - gipfelt in der Annahme des lyrischen Ichs, der Himmel sei schief (V 7). Im Angesicht dieser modernen Technik, die der Mensch geschaffen hat, werden selbst Gestirne bedeutungslos: Der Mond ist nur noch ein „weißer Tropfen“ (V 8)[151].
Der Topos Tempo, der hier in dem Erlebnis der Autofahrt dargestellt ist, funktioniert gleichzeitig zur Verallgemeinerung des Großstadtwesens überhaupt. Denn Berlin begann sich zwischen 1870 und 1920 mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auszudehnen. Die Auswirkungen dieses Prozesses bekamen die Menschen in allen Lebensbereichen zu spüren, und sie empfanden das als größtenteils beängstigend[152]. Gleichzeitig wussten sie, dass sie die Möglichkeiten, die Berlin ihnen als moderne Großstadt bot, andernorts nicht finden würden und waren fasziniert von der Stadt. So kann Ernst Blass’ Gedicht als Allegorie auf die Entwicklung Berlins verstanden werden. Die Menschen in Berlin und das sich im Auto fortbewegende lyrische Ich erfahren Tempo als Rausch und Macht - aber auch als unaufhaltsam und bedrohlich.
In der ambivalenten Darstellung der Autofahrt lässt sich hier bereits die Skepsis der Dichter gegenüber den technischen Errungenschaften und ihren Auswirkungen auf die Menschen ablesen, die die Berliner Expressionisten von den italienischen Futuristen unterschied[153].
Auch in der hier folgenden Auswahl von Berlin-Lyrik ist die pure Begeisterung über die Technik eher selten, und wenn, dann ist sie immer mit einer guten Portion Unbehagen gemischt. Von Technik-Kult wie bei den Futuristen und „positiver Einschätzung“[154] des Themas in der Literatur ist in dieser Auswahl von expressionistischen Gedichten nichts zu spüren.
Der Bewegung und dem Tempo von Ernst Blass’ „Autofahrt“ ist in „Berlin 2“ (1910) von Georg Heym, Trägheit und Unbeweglichkeit entgegengesetzt.
Auf der Straße drängen sich Busse (V 7), Automobile (V 8) und Menschenmassen (V 3). Der Verkehr bewegt sich Richtung Stadt, doch es wird nicht klar wie schnell das geschieht, denn das Verb zur Beschreibung dieses Vorganges fehlt: „Dem Riesensteinmeer zu“ (V 9), so dass der Leser die Fortbewegung der Verkehrs- und Menschenmassen nur als ein langsames, kontinuierliches Schieben erahnen kann. Die Metapher der Erstarrung steht bei Georg Heym als Kritik einer lebensfeindlichen und unveränderlichen Zivilisation gegenüber, als welche er die wilhelminische Gesellschaft empfunden hat.
Starrheit bedroht auch in Ernst Blass’ Gedicht „Ende“ das lyrische Ich:
Und immer wieder steinern dampft Berlin
(V 3).
In der Konfrontation mit der Wirklichkeit der Stadt erscheint alles unveränderlich: von „feste[m] Brauch“ (V 7), Mädchen, die „tun, als sein sie ewig hier“ (V 9) und von Lesbierinnen (V 16), die „sitzend immer“ wie marmoriert erscheinen (V 15), ist die Rede. Das Leben in der Großstadt ist zum Selbstzweck einer zerstörerischen Zivilisation geworden, die bestimmt wird von Verkehr (V 4 u. 10), Kapitalismus und Konsum (V 5) sowie von Prostitution (V 9). Lebensangst und Selbstentfremdung des Einzelnen sind das Resultat[155].
Georg Heym nennt Berlin ein „Riesensteinmeer“ (V 9) und Oskar Loerke macht in seinem Gedicht „Blauer Abend in Berlin“ (1911) die ganze Stadt zu einer Unterwasserwelt. Für die Beschreibung der Großstadt, insbesondere des Verkehrs, verwenden die Dichter Naturmetaphern. Die Natur selbst ist aus den Gedichten der Expressionisten entwichen, doch die Naturmotive sind geblieben. Das lässt vermuten, dass den Dichtern das Wortmaterial zur Darstellung der Großstadt noch fehlt[156]. Es ist aber in vielen Fällen auch bewusst gewählt, wie zum Beispiel in dem Gedicht „Auf der Terrasse des Café Josty“ von Paul Boldt (1912), wo die Stadtlandschaft als „eine Art ,zweiter’ oder ,falscher’ Natur“[157] dargestellt wird.
 Auch hier kann der Mensch diese Ersatznatur weder begreifen
noch beherrschen. Paul Boldt potenziert alle bisherigen
negativen Präsentationen des Großstadtlebens in diesem Gedicht.
Es geht um die Beschreibung des Potsdamer Platzes von der
Terrasse des berühmten Literatencafés ,Josty’ aus. Das Szenario
wird als überwältigendes Naturschauspiel eingeführt: von „ewigem
Gebrüll“ (V 1) und „vergletscherten Lawinen“ (V 2) ist die Rede.
Im Gegensatz dazu sind die Menschen bedeutungs- und machtlos:
Personen rinnen über den Asphalt wie schmutziges Wasser (V 5),
als niedere Insekten: „ameisenemsig“ und Reptilien: „wie
Eidechsen flink“ (Z 6) ist ihre Existenz nur von Instinkten
geprägt. Die Bezeichnung „Menschenmüll“ (V 4) ist in diesem
Zusammenhang bestimmt die provokanteste Art, Menschen in der
Großstadt als bedeutungslos zu bezeichnen. Das Individuum
existiert nur noch in der Masse, die bewusstlos durch die Stadt
treibt (V 7). Die Beschreibung des Potsdamer Platzes als eine
Höhle (V 9) und ein Nest (V 13) verdeutlicht, dass es in der
Großstadt, im Gegensatz zur richtigen Natur, keinen Flucht- oder
Schutzort mehr gibt. Die Bewohner sind der Stadt machtlos
ausgeliefert.
Auch hier kann der Mensch diese Ersatznatur weder begreifen
noch beherrschen. Paul Boldt potenziert alle bisherigen
negativen Präsentationen des Großstadtlebens in diesem Gedicht.
Es geht um die Beschreibung des Potsdamer Platzes von der
Terrasse des berühmten Literatencafés ,Josty’ aus. Das Szenario
wird als überwältigendes Naturschauspiel eingeführt: von „ewigem
Gebrüll“ (V 1) und „vergletscherten Lawinen“ (V 2) ist die Rede.
Im Gegensatz dazu sind die Menschen bedeutungs- und machtlos:
Personen rinnen über den Asphalt wie schmutziges Wasser (V 5),
als niedere Insekten: „ameisenemsig“ und Reptilien: „wie
Eidechsen flink“ (Z 6) ist ihre Existenz nur von Instinkten
geprägt. Die Bezeichnung „Menschenmüll“ (V 4) ist in diesem
Zusammenhang bestimmt die provokanteste Art, Menschen in der
Großstadt als bedeutungslos zu bezeichnen. Das Individuum
existiert nur noch in der Masse, die bewusstlos durch die Stadt
treibt (V 7). Die Beschreibung des Potsdamer Platzes als eine
Höhle (V 9) und ein Nest (V 13) verdeutlicht, dass es in der
Großstadt, im Gegensatz zur richtigen Natur, keinen Flucht- oder
Schutzort mehr gibt. Die Bewohner sind der Stadt machtlos
ausgeliefert.
In dem Bild der bedrohlichen Natur stellt Paul Boldt seine Erfahrungen mit der großstädtischen Zivilisation dar[158], die für ihn Untergang und Verfall bedeutet.
Von Faszination ist in diesem Gedicht keine Spur, doch die Begeisterung der Dichter gegenüber Berlin drückt sich nicht nur innerhalb eines Gedichtes aus, sondern auch in ihrer Gegenüberstellung. Vergleicht man die Gedichte „Auf der Terrasse des Café Josty“ und „Der Potsdamer Platz“, so wird das deutlich. Beide sind zur selben Zeit entstanden und zeigen von demselben Ort einen komplett anderen Eindruck, denn René Schickele zeichnet ein sehr positives und enthusiastisches Bild vom „Potsdamer Platz“ (1910).
 Der Sonnenuntergang taucht alles in gelb-goldenes Licht, und
diese Sonnenuntergangsstimmung auf dem Potsdamer Platz scheint
das lyrische Ich in eine Art von Rausch zu versetzen. Die
Adjektive „vergoldet“ (V 1), „märchenschön“ (V 3) und
„glitzernd“ (V 4) evozieren eine fabel-hafte Stimmung. Gegen ein
Märchen im traditionellen Sinn spricht die Tatsache, das die
Frauen vor „glitzernden Läden stehn“ bleiben (V 4), und der
Glanz auf diese Weise mit Konsum in Verbindung gebracht wird, er
scheint käuflich zu sein, so wie vielleicht auch die Frauen, die
sich von diesem Glanz angezogen fühlen. Vers fünf bildet den
Höhepunkt in der Beschreibung des Platzes:
Der Sonnenuntergang taucht alles in gelb-goldenes Licht, und
diese Sonnenuntergangsstimmung auf dem Potsdamer Platz scheint
das lyrische Ich in eine Art von Rausch zu versetzen. Die
Adjektive „vergoldet“ (V 1), „märchenschön“ (V 3) und
„glitzernd“ (V 4) evozieren eine fabel-hafte Stimmung. Gegen ein
Märchen im traditionellen Sinn spricht die Tatsache, das die
Frauen vor „glitzernden Läden stehn“ bleiben (V 4), und der
Glanz auf diese Weise mit Konsum in Verbindung gebracht wird, er
scheint käuflich zu sein, so wie vielleicht auch die Frauen, die
sich von diesem Glanz angezogen fühlen. Vers fünf bildet den
Höhepunkt in der Beschreibung des Platzes:
In Blüten schwimmt der Potsdamer Platz.
Mit dieser Aussage ist die traditionelle Naturlyrik umgekehrt, denn dass mit „Blüten“ Pflanzen gemeint sein sollen, ist auf den Potsdamer Platz bezogen sehr unwahrscheinlich[159]. Wenn hier, wie in vielen anderen Gedichten, die Naturmetapher zur Beschreibung von Technik benutzt wird, dann könnten mit „Blüten“ die bunten Lichter der Cafés oder der Reklametafeln gemeint sein. Da Blüten aber auch als Symbol für junges Leben, Lebensfreude oder sogar fleischliche Lust stehen[160], könnte es sich auch auf Frauen beziehen, die über den Platz spazieren, und den Betrachter in eine erotische Stimmung versetzen. Die Aussage, dass der Platz schwimmt, deutet wiederum auf die rauschhafte Empfindung des lyrischen Ichs hin.
Paul Boldt macht in „Berlin“ (1914) wieder die Stadt zu einer Landschaft. Die Straßen mit dem Verkehr und den Lichtern werden mit Substantiven wie „Jägersignale“ (V 1), „Täler“ (V 2), „Schüsse“ (V 3) und „Forst“ (V 9) in Verbindung mit den Attributen „bewaldend“ (V 2) und „wild“ (V 7) wie eine Jagd durch den Wald beschrieben. Die daktylische Versform vor allem des ersten und zweiten Verses, der Zeilensprung im Rhytmus, leitet ganz leicht vom ersten in den zweiten Vers, erzeugt dazu noch einen Rhytmus, der an einen Galopp erinnert. Die Stadt mit ihrem Verkehr wird personifiziert, sie wird zum Jäger, der mit Licht schießt (V 3). Das, was von der wirklichen Natur in der Großstadt übrig geblieben ist, der Himmel, die Nacht und die Spree, erliegt der Jagd: der Himmel brennt (V 4), die Spree sucht Retter (V 6) und die Nacht flieht von Berlin geblendet in den Forst (V 9). Die Natur unterliegt den Auswirkungen der Großstadt, die Nacht ist keine Nacht mehr, denn Berlin „webt“ einen weißen Abend (V 12). Der Mensch spielt dabei keine Rolle, er ist nicht mal mehr erwähnt. Nur indirekt wird die Beziehung der Stadt zu seinen Einwohnern beschrieben: „Ein Menschenhände-Fangen treibst du“ (V 14).
Mit dieser Du-Anrede, die Berlin nochmal personifiziert, und die in der dritten Strophe bereits beginnt (V 10), wird die Passivität der Menschen endgültig. Anders als diese lebt und handelt die Stadt (V 10 u. 12). Die Natur selbst wird in der Großstadt-Lyrik zurückgedrängt. Die „Landschaftschilderung“ dient der Subjektivierung der Stadt, und ist als Reflexion der inneren Ängste zu verstehen. Es ist die Erfahrung von Orientierungslosigkeit und von Entfremdung in der Großstadt, die bereits in den Gedichten „Auf der Terrasse des Café Josty“ und „Autofahrt“ thematisiert ist.
Mit Hilfe von Metaphern werden der Verkehr, die Lichter und die Stadt personalisiert. Die „Verdinglichung des Subjektes“[161] korrespondiert mit diesem Vorgang. Das ist der lyrische Ausdruck, das von Simmel beschriebene „Überwuchern“ der „ungeheuren Organisation von Dingen und Mächten“[162] in der Großstadt, als Auswirkungen des Prozesses der Moderne darzustellen.
So gut wie keine Naturmetaphern braucht Alfred Lichtenstein in „Sonntagnachmittag“ (1912) zur Konstruktion seines Berlins. Nur in Zeile eins entwirft er mit den Ausdrücken „faule[n] Straßen“ und „Häuserrudel“ ein abstoßend absurdes Szenario. Anstelle von Verkehr, der wie in den vorangegangenen Beispielen als Natur empfunden wird, kehrt Lichtenstein die Wahrnehmung um, so dass Natur jetzt wie Technik klingt:
Wie Schreibmaschinen klappern Droschkenhufe

(V 9).
Das an eine Reihe von belanglosem Aufzählen angeschlossene, brutale Ende:
Ein Mann zertrümmert eine morsche Frau[.]
(V 16),
zeigt wieder die Verdinglichung eines menschlichen Subjektes, da die Begriffe „zertrümmern“ und „morsch“ im normalen Sprachgebrauch nur für Gegenstände benutzt werden. Das besonders schockierende an dieser Darstellung ist zunächst die durch den Reihungsstil bewirkte Emotionslosigkeit der Schilderung. Hinzu kommt außerdem das Konkrete dieser Aussage: Ein Mann wird gewalttätig gegenüber einer Frau. Im Kontext der Aufzählung des Großstadtgeschehens wirkt es, als wenn die Stadt nun auch für die Grausamkeiten der Menschen zueinander verantwortlich sei.
In den Gedichten ist die Tatsache, dass sich die Technik von ihrer ursprünglichen Aufgabe emanzipierte, und die Menschen immer mehr der Sachwelt und ihrer objektiven Notwendigkeit ausgeliefert waren[163] - als Gegenüberstellung von „aggressiver Dingwelt“ und „Verdinglichung des Subjektes“[164] - wie bereits anhand obiger Beispiele gezeigt, ausgedrückt.
Armin T. Wegner macht diesen Prozess in seinem Gedicht „Das Warenhaus“ (1909/13) zum Hauptthema. Schon früh (1909) beschreibt der Dichter hier die Dinge als personifiziert und die Menschen als den Dingen Untertan. Menschen sind nur der „Wind“ (V 40), der durch das Haus weht. Dabei sind die Dinge aber nicht wirklich lebendig, sie wirken nur „wie Lebendige“ (V 36). Sie sind tot: erhängt (V 41), kopflos (V 42), ungeboren (V 43) altern und verblühen, sobald sie herausgetragen werden (V 64-66). Hier handelt es sich aber weder um eine personalisierende Metaphorik, die die Dinge lebendig macht, noch um eine dämonisierende, die in den Gegenständen das Wirken einer „gottähnlichen teuflisch-feindlichen Macht“ sucht[165]. Vielmehr sind es die toten Dinge selbst, die lebendig tun:
Die Dinge, in Glanz und in Leuchten geschlagen,
Die jung sind und zart zu fühlen[…]
(V 62 u. 63).
Armin T. Wegner entlarvt hier den „gespenstisch-aggressiven Charakter des Warenfetischismus“[166]. Dabei verlieren die Waren an sich nicht nur im „Elend des Alltags“ (V 66) ihren Zauber, sondern auch nachts, wenn die Lichter erlöschen, sind sie „entgeistert und leer“ (V 86). Der Dichter zeigt in seinem Gedicht den Kapitalismus der Großstadt als kalt, berechnend und herzlos, dem die Menschen aus Unerfahrenheit oder Schwäche ausgeliefert sind, beziehungsweise sich ihm selber ausliefern.
Die Dinge im Warenhaus haben den Bezug zu ihrer Produktion verloren, sie sind nur noch „ein unfruchtbarer Samen“ (V 56). Der moderne Produktionsprozess, der auf dem Prinzip kalkulierender Berechnung basiert[167], führt zum Entfremdungsverhältnis zwischen Menschen, Natur und sich selbst[168]. Das Warenhaus ist wie die Großstadt ein völlig vom Menschen geschaffener Lebensraum. Den Menschen tritt hier wie da die Kompaktheit der äußeren Welt entgegen, die Großstadt wird zum Gegenspieler[169].
Mit der Personifizierung der Großstadt, wie sie in den Gedichten „Berlin“ von Paul Boldt und „Der Potsdamer Platz“ von René Schickele bereits angedeutet ist, geht auch eine zunehmende Passivität der Menschen in der Großstadt einher.
In den Gedichten „Auf der Terrasse des Café Josty“ und „Das Warenhaus“ wird diese Passivität durch die Verwendung von Naturmetaphern ausgedrückt, und in „Berlin“ von Paul Boldt so wie in „Berlin 1“ von Georg Heym bleiben die Menschen in der Stadt ganz unerwähnt. Nur die persönliche Anrede Berlins lässt bei Ersterem noch auf einen Redner, ein lyrisches Ich, schließen, während bei Letzterem die Fässer wie von selbst rollen (V 1 u. 2), und der Mensch seine Bedeutung als Arbeitskraft verloren zu haben scheint. Ein schnelles Wachstum in allen Bereichen der Gesellschaft hatte in Deutschland, vor allem aber in Berlin, eine langsame Veränderung, und damit auch eine Anpassung der Menschen an die neuen Verhältnisse verhindert. Die einzelnen Individuen sahen sich plötzlich einem verdinglichtem System gegenüber und fühlten sich funktionslos.
In „Ende...“ (1912) von Ernst Blass existiert zwar ein Ich, doch dieses kann nur noch passiv reagieren und seine Bewegung nicht mehr selbst steuern: es wird „fortgetragen“ (V 1). Die Ohnmacht des Individuums entspricht hier der Übermacht der Großstadt.
In „Berliner Abend“ (1914) lässt Paul Boldt das Subjekt dann ganz weg. Kein Ich läuft mehr durch die Straßen, vielmehr wird der Vorgang des Gehens in der Substantivform des Infinitivs zu einer allgemeinen und endlosen Bewegung:
Spukhaftes Wandeln ohne Existenz[!]
(V 1).
Der Mensch ist vereinsamt, isoliert, geblendet und betäubt. Im Gegenzug sind die Dinge nun belebt: Asphalt dunkelt (V 2), das Gas schmeißt sein Licht (V 2 u. 3), Straßen horchen und riechen (V 4), Autos schreien und suchen sich (V 5 u. 6) und Stadtbahnzüge ziehen ein (V 8). Wie eine Zusammenfassung endet die Aufzählung dieser Personifizierungen in der Personifizierung Berlins:
Und sehr weit blitzt Berlin[.]
(V 9).
Das Ich erlebt die Umwelt nicht nur als belebt, die Dinge haben scheinbar jene Aktivität erlangt, die den Menschen abhandengekommen ist. Das gilt in besonderem Maße vom modernen Verkehr[170].
Wie schon in Paul Boldts Gedicht „Berlin“ beherrscht auch in „Berliner Abend“ wieder das Licht die Szenerie der großstädtischen Nacht. Hier wird keine finstere Großstadt beschrieben, sondern ein modernes von Laternenschein, Schaufenstern, Reklameleuchten und Autoscheinwerfern blitzendes Berlin des 20sten Jahrhunderts[171]. Die Nacht ist nur noch ein „stummer Vogel“ (V 12), sie hat ihre Macht gegenüber der modernen Großstadt eingebüßt und wird zum künstlichen Lichttag.
Trotzdem kann das die Bewohner der Stadt nicht vor dem Walten anderer Naturkräfte bewahren, denn Frost und Wind treiben als Raubtier (V 10 u. 11) über der Stadt ihr Unwesen. Sie bringen Unheil in die Großstadtnacht.
Die Personifizierungen von Verkehr und Natur stehen sich in „Berliner Abend“ gegenüber. Das Leben in der Großstadt wird nur noch von Technik oder von Natur bestimmt. Die Natur wird dabei als tierisch, die Technik als menschlich dargestellt. Die Menschen sind hier nicht mehr nur handlungsunfähig, sie haben sogar jegliche Bedeutung verloren.
Individuen existieren in den Gedichten zum großen Teil nur
noch als Masse: Sie sind Menschenströme (V 16), „Wind“ (V 40)
und „Wogen“ (V 19) im „Warenhaus“, Wassermassen (V 5) im „Café
Josty“, „Sand“ (V 13) in „ Blauer Abend in Berlin“ und
„Schritte“ (V 2) in „Ende“:

Glashaft und stier werde ich fortgetragen
Von Schritten, die im Takt nach vorne fliehn
Und immer wieder steinern dampft Berlin,
(„Ende...“, Ernst Blass, 1912, V 1-3).
Das Ich ist zerbrechlich und machtlos gegenüber der Stadt, die ewig zu sein scheint (V 3). Dieser Selbstverlust des Individuums in der Masse geht mit „der Entwicklung einer Eigendynamik und Eigengesetzlichkeit des Lebens in der Stadt (und schließlich der Stadt selbst) einher[...]“[172].
Es ist die Stadt als Ballungsraum mechanischer Funktionen und als lärmendes Labyrinth, dessen zwingende Dynamik die Massen ergreift[173]. Berlin ist in dieser Schilderung ein lautes, starres, kaltes und feindliches Gebilde, dem das Ich nicht mehr gewachsen ist. Die subjektive Beschreibung des Stadtgeschehens endet in einer Wahnvorstellung.
Das Subjekt-Objekt-Verhältnis wurde von der modernen Großstadt umgekehrt. Das Ich ist fremdbestimmt, es ist nicht mehr das aktiv handelnde Subjekt. Der Punkt verwischt, an dem das Ich aufhört, und die als „übermächtig erfahrene Umwelt anfängt“[174]: Das Ich verliert die Orientierung, es kommt zur
Dissoziation des Wahrnehmungssubjekts angesichts einer im modernen Lebensraum ihm begegnenden, nicht mehr integrierbaren Wahrnehmungsfülle[175].
Dieser Realitätszerfall ist die Antwort auf die zunehmende Ökonomisierung und Mechanisierung des äußeren Lebens, das besonders in den Metropolen spürbar war. Das Thema der Ich-Dissoziation, das als „Grundierung für nahezu alle wichtigen Themen expressionistischer Lyrik“[176] gesehen werden muss, hängt somit eng mit der Großstadt zusammen, denn diese ist für das Schiksal der in ihr lebenden Menschen bestimmend.
Wie weit diese Einflußnahme Berlins ging, drückt Oskar Loerke in „Blauer Abend in Berlin“ (1911) aus: Berlin wird hier zu einer Unterwasserwelt, und die Menschen, die hier leben, werden von der Stadt gelenkt, wie Sand vom Meer:
Die Menschen sind wie grober bunter Sand
Im linden Spiel der großen Wellenhand[.]
(V 13 u. 14).
 René Schickele weist ebenfalls auf diese Tatsache in seinem
Gedicht „Sonnenuntergang in der Friedrichstraße“ (1910) hin.
Dieser kurze lyrische Blick auf einen Mann, der auf einer
belebten Berliner Straße steht, aber in sich versunken: „mit
verklärtem Gesicht“ (V 2) und empfindungslos ist:
René Schickele weist ebenfalls auf diese Tatsache in seinem
Gedicht „Sonnenuntergang in der Friedrichstraße“ (1910) hin.
Dieser kurze lyrische Blick auf einen Mann, der auf einer
belebten Berliner Straße steht, aber in sich versunken: „mit
verklärtem Gesicht“ (V 2) und empfindungslos ist:
Du stößt ihn an,
er merkt es nicht
(V 3 u. 4),
beschreibt schon 1910 die Abgestumpftheit von Menschen in der Großstadt, die Georg Simmel in seinem Aufsatz ‚Die Großstädte und das Geistesleben’[177] als „Blasiertheit“[178] bezeichnet.
Die absolut passive Haltung des Mannes lässt den Eindruck zu, dass er selbst an der Gestaltung seines Geschickes unbeteiligt ist. Es scheint vielmehr, als ob nur der Himmel, auf den er starrt (V 5), ihm eine Antwort auf sein Schiksal geben könnte.
So wie die moderne Großstadt zur typischen Lebensform wurde, so begann sie auch das Schicksal der Menschen in ihr zu bestimmen.
Die Umstrukturierung der Arbeitswelt seit der industriellen Revolution und die immer weiter fortschreitende technische Entwicklung wirkte sich dabei in alle Gebiete des städtischen Lebens aus. Der Einzelne war hier mit „dem direkten und totalen Anspruch einer übermächtigen Industriewirklichkeit konfrontiert“[179].
Wie diese Anballung moderner Technik das Leben der Großstädter bestimmt, beschreibt Georg Heym in „Berlin 1“ (1910), indem er die Idylle mit dem Panorama der Industriestadt als kontrastierendes Nebeneinander von Vergnügungsdampfer (V 5) und Industriedreck aufeinander treffen lässt:
Zwei Dampfer kamen mit Musikkapellen.
[...]
Rauch, Ruß, Gestank lag auf den schmutzigen Wogen
(V 5-7).
Heym macht hier darauf aufmerksam, dass in Berlin die dreckige stinkende Industriewelt gleichzeitig auch die Welt ist, in der ein Großstädter seine Freizeit verbringt. Der Gegensatz von Industriewelt und persönlichem Freiraum spitzt sich zu und endet im letzten Terzett im 14. Vers: das Idyll ist zwischen Riesenschloten eingeklemmt. Der Lebensraum des Städters ist von der Industrie beschnitten, er kann in der Großstadt nicht frei sein.
 Paul Zech wagt mit seinem Gedicht „Droschkenpferde“ (1921)
einen modernen Blick auf die Technik und den Fortschritt in
Berlin. Es ist ein spätexpressionistisches Gedicht und stellt
eine Art von Rückblick dar, denn Droschkenpferde sind als
Verkehrsmittel veraltet, da sie größtenteils längst durch S- und
U-Bahn, Automobil und Bus ersetzt worden sind. Zech zeigt hier,
dass das Alte der Modernisierung in der Großstadt nicht entgehen
kann, und dass es wie in diesem Fall, auf der Strecke bleibt.
Der Dichter schaut in umgekehrte Richtung: nicht die Technik in
Form neuer Verkehrsmittel ist sein Thema von Berlins Straßen,
sondern mit dem, was vorher war und jetzt verdrängt wird,
problematisiert er den Modernitätsprozess der Großstadt. Sein
Blick bleibt dabei frei von Mitleid. Der Großstadtmensch, der
Fortschritt und Modernität verkörpert, fühlt Ekel beim Anblick
der Droschkenpferde (V 14), nur Kinder, die noch unschuldig
sind, und von diesem Empfinden nicht betroffen, können in den
Pferdekutschen ein schönes Bild sehen.
Paul Zech wagt mit seinem Gedicht „Droschkenpferde“ (1921)
einen modernen Blick auf die Technik und den Fortschritt in
Berlin. Es ist ein spätexpressionistisches Gedicht und stellt
eine Art von Rückblick dar, denn Droschkenpferde sind als
Verkehrsmittel veraltet, da sie größtenteils längst durch S- und
U-Bahn, Automobil und Bus ersetzt worden sind. Zech zeigt hier,
dass das Alte der Modernisierung in der Großstadt nicht entgehen
kann, und dass es wie in diesem Fall, auf der Strecke bleibt.
Der Dichter schaut in umgekehrte Richtung: nicht die Technik in
Form neuer Verkehrsmittel ist sein Thema von Berlins Straßen,
sondern mit dem, was vorher war und jetzt verdrängt wird,
problematisiert er den Modernitätsprozess der Großstadt. Sein
Blick bleibt dabei frei von Mitleid. Der Großstadtmensch, der
Fortschritt und Modernität verkörpert, fühlt Ekel beim Anblick
der Droschkenpferde (V 14), nur Kinder, die noch unschuldig
sind, und von diesem Empfinden nicht betroffen, können in den
Pferdekutschen ein schönes Bild sehen.
Von so einem Großstadtmenschen handelt „Ankunft in Berlin“ (1914) von Max Herrmann-Neiße, doch nähert sich dieser auf sarkastische Weise den Problemen von Modernität und Großstadt: In Erwartung einer solchen - mit allen technischen Errungenschaften - kommt das lyrische Ich in Berlin an. Aber statt einem Szenario aus Luftschiffen (V 1), Trambahnen (V 8) und Automobilen (V 8-10):
 [...] hockten wir plötzlich hinter einem
[...] hockten wir plötzlich hinter einem
verpfuschten Pferde[,]
(V 13 u. 14).
Auch hier steht das Droschkenpferd für Veraltetes und Rückständiges, und so bestimmt Enttäuschung über diesen provinzlerischen Empfang die Ankunft. Mit diesem nüchternen und kritischen Blick auf die Großstadt Berlin gehört Max Herrmann-Neiße schon zu den Begründern der sich in den 20er Jahren etablierenden Gattung der ‚Neuen Sachlichkeit’, zu der er als Autor ebenfalls zu zählen ist.
Einen Rückblick ganz anderer Art bietet Iwan Goll in „Hedwig Warmbier, Blumenfrau auf dem Potsdamer Platz“ (1919). Die Thematisierung von tosendem Verkehr und Menschenmassen in der mittleren Strophe wirkt wie ein ironischer Kommentar auf die frühexpressionistische Lyrik, in der die Darstellung von Verkehr, vermittelt in Naturmetaphern, ein wichtiges Ausdrucksmittel war. Um den Verkehr dieses Platzes zu beschreiben, greift Goll auf Naturmetaphern zurück („Autobusse flattern“ V 8). Meines Erachtens wählt er diese Formulierung nicht, um seinen Gefühlen beim Erleben von Stadt Ausdruck zu verleihen – so wie es bei den oben aufgeführten Beispielen der Fall war. Denn die Vorstellung, dass schwere Busse wie Fledermäuse flattern klingt sehr unwahrscheinlich und grotesk. Auch die absurde Aufforderung:
Aber laß dich vom Gebrüll umtaumeln[,]
(V 6),
verstärkt nur den Eindruck, dass es sich hier vielmehr um eine kritische Auseinandersetzung mit der frühen Phase seiner expressionistischen Kollegen handelt.
Die hier aufgeführten Gedichte der Straßen zeugen von den Begegnungen der Menschen mit der Stadt. Die Stadt stellt sich dabei als optisches (Licht), akustisches (Lärm) und motorisches (Turbulenzen, Bewegung) Gebilde dar[180].
Eine Ausnahme bildet das Gedicht „Berlin 5“ (1910) von Georg Heym: In Kombination mit der Assoziation von Ratten, Bahnhof und Menschenmenge entsteht hier auf eine ganz andere und subtile Weise ein Stück Großstadt.
Was Eberhard Roters für die expressionistische Bildende Kunst als charakteristisches Merkmal der Großstadtstraße festmacht, gilt auch für die Lyrik: die Großstadtstraße ist Besitz, Wirkungsstätte und Bedrohung der Menschen[181].
Die Eroberung der Straße durch den Bürger, die aus dem Willen zur gesellschaftlichen und individuellen Freiheit entstanden ist, bedeutet damit gleichzeitig auch
die volle Anerkennung des existentiellen Risikos und die volle Aufsichnahme der existentiellen Verantwortung[182].
Freiheit wird zur Bedrohung und zum Abgrund. Die Straße wird zum Schauplatz im Spannungsfeld von Selbstbehauptung und Neurose. Ursache dieses Zustandes, das hat die Betrachtung der Straßen-Gedichte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt, ist die Großstadt.
Die Straße erscheint als sinnlicher Ort, sie wird zur Großstadt selbst, und damit zum Schicksal des modernen Menschen.
| < zum Textanfang |